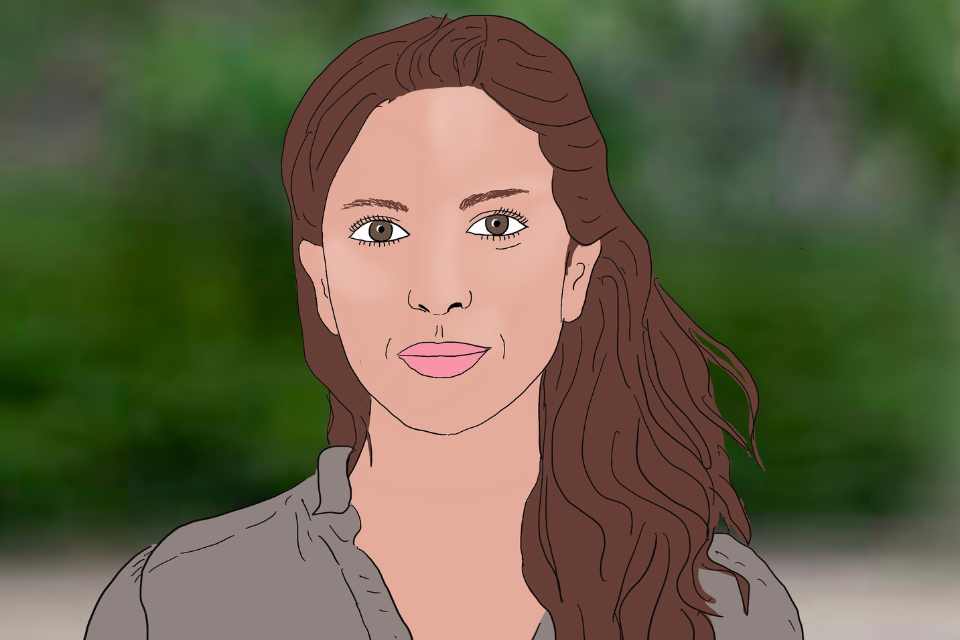Rassistische Polizeigewalt in Frankreich, Klassenkampf von oben in Deutschland, der erste CSD in Bautzen und Diskriminierung beim MDR. Der Wochenrückblick aus feministischer Perspektive ist zurück aus der Sommerpause. #KW27
Montag, 3. Juli
In Frankreich wurde am 27. Juni ein 17-jähriger Junge bei einer Verkehrskontrolle von der Polizei erschossen. Nahel Merzouk ist einer von vielen Jugendlichen und jungen Männern mit nordafrikanischem oder subsaharischem Hintergrund, die in Frankreich rassistischer Polizeigewalt, nicht selten mit tödlichem Ausgang, ausgesetzt sind. „Für diese Jugend ist Ungerechtigkeit nicht nur ein Gefühl. Die Fälle werden häufig nicht weiter verfolgt und die mörderischen Polizist*innen selten verurteilt. Die Angst, in eine Polizeikontrolle zu geraten, wird nur von ihrem Hass auf die Institutionen eines Systems übertroffen, das nur dazu da ist, diese Schichten von Jugendlichen aus den Arbeitervierteln zu unterdrücken und zu erniedrigen“, schreibt die französische Gruppe „Alternative Socialiste Internationale“ (ASI) in einer Stellungnahme, die in deutscher Übersetzung hier nachgelesen werden kann. Seit der Tötung des fliehenden Jugendlichen (die Polizei hatte zunächst behauptet, Nahel sei mit seinem Auto auf sie zugerast, doch ein Video der Szene belegte schnell das Gegenteil), kommt es in vielen Städten Frankreichs zu Protesten, zu Sachbeschädigungen und Bränden. Es ist eine Revolte derer, deren Stimmen nicht gehört werden. Und ja, die Ausschreitungen sind voller Gewalt. Doch vor allem ist es eine Reaktion: „Die erste Gewalt ist die rassistische und sozioökonomische Gewalt, die von der Politik ausgeht, die das System hervorbringt und die Macron heute betreibt“, schreibt die ASI und stellt fest: „Sie sind es, die (…) die Gewalt seitens eines Teils der Revoltierenden anregen.“ Der unterkomplexe Gewaltbegriff der Bürgis, die nur das als Gewalt anerkennen, was als unmittelbarer Schaden, wie zerbrochene Scheiben und brennende Autos, sichtbar ist, ist Teil des Problems. Wir müssen über die Gewalt reden, die von Politik, Polizei und Justiz ausgeht. Den Opfern dieser Gewalt wird nicht nur die Anerkennung als Opfer verwehrt, sie werden vielmehr zu Tätern gemacht. ASI schreibt: „Bei den Revolten, die wir in den Stadtvierteln heute erleben, steht die Polizei vor jungen Männern, die von klein auf diskriminiert und gedemütigt wurden, ein Prozess, der während der Covid-19-Pandemie noch verstärkt wurde.“ Brandschatzung, Plünderungen und Zerstörung sozialer Infrastruktur sind Ausdruck unbändiger Wut derer, für die das System nichts als Ausschluss und Unterdrückung bereithält. Der emanzipatorischen Bewegung schaden die Ausschreitungen derzeit mehr als sie nutzen, sie machen es den Bürgis viel zu leicht, sich zu distanzieren und in ihren bequemen Sesseln sitzen zu bleiben. Doch ist es nicht die Aufgabe der Wütenden, hier Brücken zu bauen. Es braucht eine geschlossene Linke, die die Aufstände der Jugend zu einer Massenbewegung werden lässt. Auch wenn deren Protestformen uns nicht gefallen mögen, unsere Solidarität sollte den Jugendlichen dennoch sicher sein. Denn wie ASI ganz richtig festhält: „Die herrschende Klasse kennt das Risikopotential einer aufbegehren Jugend, die ganze Schichten der Arbeiter*innenklasse hinter sich herziehen kann.“
In Deutschland hat ein ähnlicher Fall übrigens kaum Schlagzeilen gemacht. Der 19-jährige Bilal G. geriet am 3. Juni in Bad Salzuflen in eine Verkehrskontrolle. Weil er zwar die theoretische, aber noch nicht die praktische Fahrprüfung bestanden hat, geriet er in Panik und versuchte zu fliehen. Über 30-mal feuerten die Polizist*innen auf den jungen Mann, der schwerverletzt überlebte. Bilal G. ist aller Wahrscheinlichkeit nach querschnittsgelähmt und er ist schwer traumatisiert. Die Bodycams der 13(!) beteiligten Cops waren beim Einsatz ~natürlich~ ausgeschaltet.
Dienstag, 4. Juli
Einer der Aufreger diese Woche wäre nicht viel mehr als eine Randnotiz gewesen, wenn er nicht mitten in eine der reichweitenstärksten Bubbles des Internets gestochen hätte: Berlin Mitte Moms (die natürlich genauso in Hamburg, München oder Frankfurt leben). Weil Finanzminister Christian Lindner radikale Sparmaßnahmen fordert, entschied sich die Grüne Familienministerin Lisa Paus, die Einkommensgrenze für das Elterngeld zu senken. Paare, die im Jahr mehr als 150.000 Euro zu versteuerndes Einkommen haben, sollen künftig keinen Anspruch mehr auf Elterngeld haben. Die FDP ist empört: Streichungen und Kürzungen, ja bitte, aber doch nicht bei unseren Wähler*innen! 60.000 von 11,9 Million Familien in Deutschland wären von der Streichung betroffen. 60.000, deren Monatseinkommen bei mindestens 15.000 Euro brutto liegt. Mit Einkünften in dieser Höhe gehört man zu den Bestverdiener*innen: Im Jahr 2019 gehörte ein Paar ab einem Haushaltsnettoeinkommen von 5.780 Euro zu den obersten 10 Prozent in Deutschland. Naiv wie ich bin, dachte ich, dass Paare, die so viel Kohle haben, gar nicht auf die maximal 1.800 Euro Elterngeld pro Monat angewiesen sind, aber da hatte ich mich grässlich getäuscht. Dem Aufschrei der (potenziell) Betroffenen zufolge würden sie alle unmittelbar verarmen. Kinder? Können sie sich dann einfach nicht mehr leisten. Und überhaupt: Reich wäre man mit 180.000 Euro brutto im Jahr doch noch lange nicht. Man habe schließlich auch Ausgaben (für die Autos, die Urlaube, die Raten für die Einkommenswohnung und den ETF-Sparplan zum Beispiel). Geringverdiener*innen wie ich können das natürlich nicht verstehen. Zum Glück schwang sich schnell eine unerschrockene Führungspersönlichkeit, Vorzeige-Girl-Boss und Millionen-Erbin, Verena Pausder, an die Spitze der Verzweifelten und startete mutig eine Petition. Unter der Überschrift „NEIN zur Elterngeld-Streichung“ schreibt Pausder*: „Wird das so beschlossen, wäre es ein Schlag ins Gesicht für all die hart arbeitenden Paare in Deutschland, die mit Hilfe des Elterngelds das erste Jahr nach der Geburt finanziell überbrücken“. Klar, weil alle, die hart arbeiten, auch 150.000+ verdienen… Ich hätte ja gesagt, dass der wahre Schlag von dieser Petition ausgeht, und zwar ins Gesicht all derer, die in „systemrelevanten“ Berufen schuften, in der Pflege, als Erzieher*innen, an der Supermarktkasse oder als Müllwerker*innen. Aber für Menschen wie Pausder, die nicht nur in verschiedenen Aufsichtsräten sitzt (u.a. in dem des eigenen Familien-Konzerns Delius), sondern auch die FDP mit großzügigen Spenden unterstützt, ist harte Arbeit nur die, die fürstlich entlohnt wird. Nadine, eine von inzwischen über 500.000 Menschen, die Pausders Petition mitgezeichnet haben, fasst zusammen: „Solch eine Regelung ist ein Schlag ins Gesicht für alle, die täglich hart arbeiten, um die Gesellschaft aufrecht zu erhalten.“ Eine andere Person schreibt: „Für mich ist das Diskriminierung derjenigen, die sich unter viel Aufwand eine gute Stellung erarbeitet haben. (…) Es ist unfassbar, wie die Mittelschicht Stück für Stück auf ein Existenzminimum reduziert werden soll.“ Und Carmen findet: „Ich finde es eine Unverschämtheit , dass die Menschen, die die höchsten Steuern zahlen und dadurch dieses Land und die Bürgergeldempfänger finanzieren, diese Leistungen nicht erhalten sollen. Arbeit sollte nicht bestraft werden.“ Ach Carmen, du weißt schon, dass Menschen, die Bürgergeld empfangen ÜBERHAUPT KEIN Elterngeld erhalten, oder? Und dass das Kindergeld in voller Höhe aufs Bürgergeld angerechnet wird?
„Was wir gerade so anschaulich beobachten können, ist Klassenkampf von oben“, schrieb die Politikwissenschaftlerin und Autorin Dagmara Budak diese Woche auf Instagram: „Solidarität und Unterstützung, die sie jetzt so vehement einfordern – und wie die Zahlen zeigen, auch bekommen – verwehren sie seit eh und je anderen.“ Weder setzten sich Pausder und Co für die Kindergrundsicherung ein, noch forderten sie eine Erhöhung des Mindestlohns (klar, würde ja die eigenen Nannys und Haushaltshilfen unnötig teuer machen). Dagmara Budak schreibt: „Diese Frauen geben vor, für Gleichberechtigung und (finanzielle) Unabhängigkeit von Frauen zu kämpfen. (…) Sie kämpfen nicht für die Gleichberechtigung und finanzielle Unabhängigkeit der Frauen, die sie ausbeuten oder zu deren Ausbeutung sie beitragen“, bringt es Budak auf den Punkt.
Und während Pausder und ihre Klassenkamerad*innen laut auf die Pauke im Auftrag des eigenen Geldbeutels hauten, redete kaum jemand darüber, dass beim BAföG massiv gekürzt wird oder dass der Bundeszuschuss für die Pflege komplett gestrichen werden soll.
*Der Petitionstext wurde inzwischen offenbar geändert, aber ich hab Screenshots vom Original hehe.
Mittwoch, 5. Juli
Wo wir schon bei Sozialkürzungen sind. In Berlin-Neukölln macht der CDU-SPD-Senat seinem Ruf als Rückschrittskoalition wieder mal alle Ehre: Die Senatsfinanzverwaltung strich dem Bezirk Neukölln 22,8 Millionen Euro pro Jahr. In der Praxis bedeutet das u.a., dass in den kommenden Jahren die Tagesreinigung an den Schulen wegfällt, die aufsuchende Drogen-Sozialarbeit gestrichen, die Mittel für die Obdachlosenhilfe gekürzt und einige Spielplätze dichtgemacht werden. Weiterhin soll die Müllentsorgung in den Grünanlagen halbiert und freie Stellen in der Verwaltung nicht nachbesetzt werden. Am Mittwoch protestierten Hunderte Menschen vor dem Neuköllner Rathaus gegen die Kürzungen. Ferat Koçak von der Neuköllner Linken, die die Kundgebung angemeldet hatte, erklärt: „Es wurde gesagt, man wolle Geld in Bildung und Jugendarbeit hier in Neukölln stecken. Stattdessen fließt das Geld in die Kottiwache, in Taser und Bodycams für die Polizei und in Razzien in Shisha-Bars.“ Aus Sicht der Herrschenden ergibt diese Verteilung allerdings vollkommen Sinn. Denn ein kaputtgesparter Bezirk bringt mehr und mehr wütende Menschen hervor, für deren Niederschlagung sich der Staat zunehmend rüstet (siehe Frankreich).
Während bei der ohnehin chronisch unterfinanzierten Sozialen Arbeit weiter gekürzt wird, wundern sich bürgerliche Parteien und Medien über den Aufstieg der Partei, die wie keine zweite versteht, individuelle Frustration und Menschenfeindlichkeit in Wählerstimmen umzumünzen. Die Tagesschau meldete am Mittwoch, dass die AfD in Thüringen inzwischen 34 Prozent erreicht. Neun Prozentpunkte als noch vor einem Jahr. Bundesweit sieht es nicht so viel besser aus: „Die AfD verbessert sich um 2 Prozentpunkte auf 20 Prozent und wäre damit zweitstärkste Kraft. Das ist der höchste Wert, der für die AfD im ARD-DeutschlandTrend je gemessen wurde“, heißt es bei der Tagesschau.
Donnerstag, 6. Juli
Gute Nachrichten gab es diese Woche zum Glück auch! Der rassistische Straßenname in Berlin-Mitte ist bald Geschichte. Der Umbenennung der M**renstraße in Anton-Wilhelm-Amo-Straße steht (fast) nichts mehr im Wege. Am Donnerstag wies das Verwaltungsgericht die Klage von Anwohnern ab. „Ausschließlich weiße Männer über 70“ (taz) waren vor Gericht gezogen, nachdem die Bezirksverordnetenversammlung Mitte die Umbenennung im August 2020 beschlossen und das zuständige Bezirksamt diese acht Monate später verfügt hatte. Einer der Kläger ist der Historiker Götz Aly. Der 76-Jährige sieht keinen Rassismus (lol), fühlt sich allerdings „selbst abgewertet, wenn er und die anderen Gegner als ‚alte weiße Männer‘ bezeichnet werden“, so die taz. Einer von Alys Mitstreitern wittert gar die große Verschwörung und „behauptet, es seien haufenweise Schwarze Menschen nach Berlin gekarrt worden, um den Eindruck zu erwecken, dass diese durch die M-Straße in ihrer Ehre verletzt würden. ‚Welche Ehre bitte?‘, fragt er“, berichtet die taz. Den Rassisten bleibt nun noch, die Zulassung der Berufung zu beantragen, was eine „aufschiebende Wirkung hätte“. Bis die Straße und die dazugehörige U-Bahnstation dann endlich den Namen des Schwarzen Philosophen Anton Wilhelm Amo tragen, der im 18. Jahrhundert an deutschen Universitäten lehrte und als Vordenker des Antirassismus gilt, müssen wir uns also weiterhin gedulden.
Freitag, 7. Juli
Bereits am vorangegangenen Samstag hatten die RBB-Moderator*innen Nadia Kailouli und Aimen Abdulaziz-Said gleichzeitig und gleichlautend folgenden Tweet abgesetzt: „Wie ihr wisst, zieht das ARD-MIMA 2024 nach Leipzig. Ich werde die Sendung dann leider nicht mehr moderieren. Laut MDR-Chefredakteurin soll die künftige Moderation einen ost-deutschen Hintergrund haben. Das muss ich so akzeptieren. Ich wünsche den Kolleg*innen viel Erfolg“. Seitdem versucht der MDR, der die Sendung vom RBB übernimmt, die Aussage als Lüge hinzustellen. Zur BILD sagte der Sender: „Eine solche Aussage hat es von MDR-Seite niemals gegeben. Der MDR steht für Vielfalt, in jeder Hinsicht, auch für das künftige Mittagsmagazin.“ Und Chefredakteurin Julia Krittian erklärte gegenüber dem Tagesspiegel: „Eine solche Aussage habe ich nicht getroffen – und eine solche Einseitigkeit wäre auch nicht meine Haltung. Sämtliche abgeleitete Interpretationen sind falsch. Richtig ist: Wir sind für die Moderation im Gespräch mit unterschiedlichen Persönlichkeiten mit ganz unterschiedlichen Hintergründen.“ (Beides zitiert nach Übermedien). Ein eher kläglicher Versuch von der rassistischen Besetzungspolitik abzulenken, denn immer mehr interne Stimmen bestätigen die Aussage von Kailouli und Abdulaziz-Said. Wie das Medienmagazin „ZAPP“ recherchierte, bestätigen mehrere Teilnehmer*innen der Redaktionskonferenz, Krittian „habe gesagt, dass man sich beim MDR in Ostdeutschland verwurzelte Menschen wünsche“. Doch es wird sogar noch ekliger. Wie „Business Insider“ am Freitag berichtete, setzte der RBB-Chefredakteur David Biesinger Nadia Kailouli per Mail unter Druck. Biesinger schreibt, der Tweet habe „bei mir – aber auch in der Chefredaktion des Mitteldeutschen Rundfunks – in einem hohen Maß Irritationen ausgelöst“. Zur entsprechenden Redaktionskonferenz sagt er: „Dieses Treffen wurde mehrfach als strikt vertraulich gekennzeichnet. Daher ist es für mich nicht nachvollziehbar, warum Sie diese Vereinbarung gebrochen haben (…) ich sehe hier eine zentrale journalistische Regel verletzt und bitte Sie bis morgen Abend um eine Stellungnahme zu diesem Vorfall.“ Nadia Kailouli antwortete ihm und erklärte, es sei dem Sender natürlich freigestellt, sich personell neu auszurichten: „Aber Ignoranz und diskriminierende Ungleichbehandlung hinterlassen einen bitteren Eindruck bei uns, der über eine Irritation hinausgeht“. Eine Ungleichbehandlung liegt zum Beispiel darin, nur die beiden weißen Moderator*innen des bislang vierköpfigen MIMA-Teams zu einem Vorsprechen beim neuen Sender einzuladen: Susann Reichenbach (aus Borna) und Sascha Hingst (Aus Ost-Berlin). Kailouli und Abdulaziz-Said seien überhaupt nicht erst gefragt worden. Ich bin sehr gespannt, wie die Sender sich da wieder rauswieseln werden.
Samstag, 8. Juli
Es ist Pride-Wochenende in Köln, das am Sonntag mit der CSD-Demonstration zu Ende geht. Ich gönne allen den Spaß, aber es fällt mir zunehmend schwer, den angeblich politischen Charakter des Events zu erkennen. Pride-Paraden in Großstädten sind nichts anderes als queercoded Werbeveranstaltungen. Was hat ein Umzug mit Wagen von BILD, Polizei, CDU, Bundeswehr oder Deutsche Bank mit queerer Befreiung zu tun? Die Veranstalter*innen des „Cologne Pride“ (ja, natürlich ist es ist eine Marke) werben ganz aktiv um die Konzerne, die mit ihrer Präsenz nichts anderes als „targeted advertising“ betreiben. „Wir freuen uns sehr, über das wachsende Interesse von Unternehmen“, erklärt Cologne Pride: „Du hast Interesse daran, dein Engagement zum Thema Diversity und deine Marke bei diesem einzigartigen Event zu präsentieren? Dann nimm Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns auf dich!“ Es ist so eklig wie normal. Währenddessen wird die Pride-Parade in Tiflis von Hunderten Nazis angegriffen und verwüstet, unter den Augen der Polizei. Queere Sichtbarkeit wird weltweit angegriffen, Menschen riskieren alles, u.a. ihr Leben, wenn sie für ihre Befreiung und die Community auf die Straße gehen, und in Deutschlands Großstädten wird ein neoliberaler Schlager-Move in Regenbogenfarben veranstaltet – das ist alles so falsch! Alternativen gibt es hierzulande genug: Pride-Veranstaltungen in Kleinstädten, ohne Konzerne, dafür mit echter Botschaft oder alternative Events, die sich bewusst vom Anbiedern an das Bürgi-Milieu distanzieren.
Viel Liebe an dieser Stelle an die rund 300 Menschen, die den ersten CSD in Bautzen am Samstag trotz Angriffen von Faschos durchgezogen haben. That’s the spirit!
Sonntag, 9. Juli
An einem durchschnittlichen Tag kommt es in Deutschland zu 432 Fällen von Partnerschaftsgewalt, das sind 18 pro Stunde. Das Bundeskriminalamt (BKA) registrierte 2022 insgesamt 157.550 Fälle. (Die Gewalttaten, von denen die Polizei nichts mitbekommt, sind selbstverständlich nicht mitgerechnet.) Das ist ein Anstieg von 9,4 Prozent gegenüber dem Jahr 2021. Der Statistik zufolge sind etwa 80 Prozent der Opfer weiblich, 78 Prozent der mutmaßlichen Täter männlich. 40 Prozent der Täter waren Ex-Partner, 60 Prozent aktuelle Partner. Die Fallzahlen von sexualisierter Gewalt sind sogar noch stärker gestiegen. 2022 zählte das BKA 20 Prozent mehr Fälle von Vergewaltigungen, sexueller Nötigung und sexuellen Übergriffen als 2021. Es sind erschreckende Zahlen, aber noch erschreckender ist für mich, dass wir das als Gesellschaft mehr oder weniger achselzuckend hinnehmen. Betroffene werden häufig von Polizei und Justiz nicht ernstgenommen, es fehlen überall Plätze in Gewaltschutzeinrichtungen und deren Finanzierung ist prekär und unsicher. Medien verharmlosen die Gewalt als „Beziehungsdrama“ oder „Ehe-Streit“ und nur 35 Prozent der Deutschen lehnen die Aussage „Auseinandersetzungen in einer Partnerschaft gehen nur die Beteiligten etwas an“ ab (48 Prozent stimmen hier ausdrücklich zu, 17 Prozent sind unentschieden).
Einer dieser Fälle ereignete sich am Montag in Frankfurt. Eine 40-Jährige, die bereits im Mai ein „Annäherungs-, Betretungs- und Kontaktverbot zu Ehefrau und Wohnhaus“ gegen ihren Ex-Partner erwirkt hatte, wurde von diesem brutal ermordet. Der 51-Jährige tötete die Frau mit mehreren Stichen in deren Zuhause. Die Mutter von drei Kindern (19, 15 Jahre und 6 Monate) hatte im Vorfeld mehrfach die Polizei informiert, auch am Tattag selbst. „Die Frau rief gegen 11 Uhr die Polizei und gab an, ihr Mann habe ihr in einem Park in der Nähe des Hauses aufgelauert und sie dort festgehalten“, berichtet die Hessenschau. Die Polizei habe im Park nach dem Mann gesucht, ihn jedoch nicht angetroffen. Wenige Stunden später tötete er sie.
2021 wurden 113 Frauen von ihrem (Ex-)Partner getötet, jeden dritten Tag passiert statistisch gesehen so ein Femizid. Zum Vergleich: Im ganzen Jahr 2021 zählte das BKA kein einziges Todesopfer durch islamistische Anschläge (2020 wurde eine Person getötet). Während die Partnerschaftsgewalt als „tragische Einzelfälle“ behandelt werden, wird die „islamistische Gewalt“ zum gesamtgesellschaftlichen Problem erklärt. Ein krasses Zerrbild unserer Realität, aber kein Zufall, sondern politisch gewollt.
Das wars für heute, ich danke euch wie immer fürs Lesen. Wer kann und will: via PayPal gibt es die Möglichkeit, ein Trinkgeld dazulassen. Oder du wirst heute Fördermitglied auf Steady und hilfst mir dabei, meine Arbeit dauerhaft zu finanzieren.